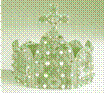|
|
Gesellschaft
e.V. |
|
|
In unserer Jahresplanung war
für Frühjahr 2007 eine Besichtigung der Kapellen im Priesterseminar, im
Diakonissenkrankenhaus und im Mutterhaus der Diakonissen vorgesehen. Wir
wollten uns dort die Glasfenster zeitgenössischer Künstler ansehen. Irmtrud
hatte sich angeboten die Erklärung der Fenster zu übernehmen. Nachdem Frau Rünzler von unserem Vorhaben erfahren hat, hat sie einen
Kontakt mit ihrem Nachbarn „Glas – Maurer“ hergestellt. So konnten wir vor der
Betrachtung der Fenster die Glas –
Werkstatt von Herrn Maurer besuchen und dort erfahren, wie die farbigen
Gläser hergestellt und zu Glasbildern verarbeitet werden, einer Glasmalerin
konnten wir bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Nachfolgend beschreibt
Sigrid Gläser die Geschichte des Diakonissenwesens und der Diakonissenanstalt,
sowie des Priesterseminars. Die Beschreibung der Glasgemälde hat Irmtrud Dorweiler beigesteuert. Glasfenster
Eine Gruppe interessierter Salier war in Speyer unterwegs um einige,
bisher noch nicht besuchte, Einrichtungen kennen zu lernen. Am 21.02.07 waren
wir zu Gast bei Glas – Maurer und am 10.03.07 beim Priesterseminar sowie bei
der Diakonissenanstalt, um hier die wunderbaren Ergebnisse der
Fensterglaskunst bekannter Künstler staunend, beinahe ergriffen, zu sehen. Ich möchte nun einen kleinen Streifzug durch die zwar bekannten,
aber in der Literatur und im Bewusstsein vieler Speyerer Bürger etwas
stiefmütterliche behandelten Einrichtungen, machen. Geschichte der
Diakonissenanstalt und des Diakonissenwesens in Speyer. In den Jahren 1854 / 55 wüteten in Speyer viele Epidemien und
Seuchen, die Not der Menschen war unvorstellbar groß. Die Kräfte der kleinen
Schar kath. Schwestern aber reichte nicht aus um
helfend da zu sein – Schwestern wurden gesucht. – Man erinnerte sich der Diakonissen der altchristlichen Kirche, der
damit verbundenen Pflege verwundeter Soldaten und auch um das Elend der Armen
in ihren Hütten zu lindern. So fing es 1833 an: In Kaiserswerth stand
die Wiege des bis heute großen umfassenden Diakoniewerkes
– das erste Diakonissen – Mutterhaus. Im Jahr 1859 kamen die ersten Probeschwestern, zwei Pfälzerinnen,
ausgebildet in Straßburg, nach Speyer. Das erste „kleine Mutterhaus“ befand
sich neben der Heiliggeistkirche. Einer der Wegbereiter der „Inneren Mission“ war Johann Heinrich Wichern, der keinen leichten Stand hatte, denn allem
„Neuen“ gegenüber waren die Menschen sehr misstrauisch. Nach nur wenigen Jahren aber war das erste Mutterhaus zu klein. Es
musste eine Lösung gefunden werden. Aber wie und welche? Die Schwesternschaft
musste und wollte wachsen, denn der akute Pflegemangel für die Kranken war
groß. Da geschah es, dass eine Witwe aus Speyer ihr Herz für die Not der
Schwestern auftat. In einem Gespräch erklärte sie sich bereit eines ihrer
Häuser zu verschenken. So wurde im Jahre 1860 das 27 Zimmer enthaltende Haus
am Georgenturm das zweite Mutterhaus. Der Umzug in das nun „große“ Haus war
1861. Es folgten sehr schwere Jahre, kaum vorstellbare Hindernisse um den
eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter zu gehen. Zunächst war im zweiten Haus genügend Platz. Neue Arbeitszweige
wurden eingerichtet z.B. eine Kinderstation. Es gab auch einen Betsaal, der
auch, trotz Widerstände, von den Bürgern besucht wurde. Die Schwesternschaft
vergrößerte sich langsam. Ab 1865 wuchs sogar die Zahl der
Außenpflegestationen in Pirmasens, Kaiserslautern und St. Ingbert. Das Werk vergrößerte sich unauffällig weiter. Diakonissenschülerinnen wurden aufgenommen, die dann mit 18 Jahren als
Probeschwestern arbeiten durften. Die Einsegnung zur Diakonissin erfolgte
erst Jahre später. 1867 – 1873 wüteten erneut Epidemien (Cholera) in Speyer. Nun wurde
durch diese menschliche Not auch das zweite Haus zu klein. 1880 schließlich
hatte man die Hoffnung, ein neues, ein drittes
Anstaltsgebäude eröffnen zu können. Aber wieder die bange Frage, wie? Wieder kam Hilfe! Zu den großen Gönnern dieser nun als dritten
geplanten Diakonissenanstalt gehörte der 1835 gebürtigte
Speyerer, aber 1853 nach Amerika ausgewanderte Heinrich Hilgard. Der zu großem Vermögen gekommene Hilgard
schenkte zum Neubau des dritten Diakonissenhauses 10.000 Mark. Es war ein
Wunder! Das war 1881. Außer der ersten Gabe stellt Hilgard
1883 noch 100.000 Mark zur Verfügung. Das Grundstück für diese neue
Einrichtung war inzwischen am Drachenturm erworben worden. 1884 kamen noch
einmal 100.000 Mark aus der neuen Welt. Im Juni 1884 war Richtfest und im
Januar 1885 die feierliche Einweihung. Zu beiden Ereignissen war auch der
Stifter Hilgard mit seiner Frau angereist. Dem Herrn und dem Gönner sei Dank. Aus einem kleinen Samenkorn war
ein großer Baum herangewachsen. Ja, meine lieben Salier, das war ein kurzer Abriss der Geschichte
dieser Krankenanstalt. Wir aber wollen dankbar sein, dass wir „hier“ und „heute“ leben
dürfen, denn was aus den schweren Anfängen geworden und immer gewachsen ist,
uns zum Wohl, das kennen wir alle. Unsere Diakonissenanstalt in der Hilgardstraße. Den vielen, vielen namenlosen Schwestern,
die an diesem Werk unermüdlich arbeiteten ein stilles Gedenken! Das KünstlerehepaarAda Isensee / Hans-Gottfried von
Stockhausen gestalteten 1989 die Fenster der Krankenhauskapelle: Schöne, aber gefährdete Schöpfung. Die seitlichen Fenster, rechts mit dem Thema Schöpfung und links mit
der Rettung aus der Sintflut wurde von Ada Isensee, die Stirnseite mit Geburt
– Tod - und Auferstehung Jesu von Hans-Gottfried Stockhausen geschaffen. Besonders beeindruckend: die Augen Gottes, die sowohl in Schuld,
Tod, als auch in der Rettung zu sehen sind als Wundmale der Hände Christi. Mutterhauskapelle: 1984 Thema: Leben, helfen, hoffen im Zeichen des Kreuzes." Im zentralen Fenster fügen sich die Bildteile wie in einem Kreuz
zusammen: von der Geburt Jesu bis zu den Emmausjüngern.
Die übrigen Fensterflächen sind durch grafisch gestaltete biblische Texte
ausgefüllt. In dieser Weise bekundet der Künstler, dass er durch sein Werk
die Verkündigung des Evangeliums bewusst mittragen möchte. Rechts und links des zentralen Fensters befinden sich die Werke der
Barmherzigkeit, somit werden die drei Fenster der Stirnwand thematisch
verbunden und weisen auf den diakonischen Beweggrund, dass Glaube in der
Liebe tätig wird. Die beiden Fenster an der Längsseite haben zum Thema Verheißung und
Hoffnung, von Noah über Abraham zu David, auch wieder umrahmt von Textstellen
aus der Bibel. Priesterseminar Die Errichtung des neuen Priesterseminars in den Jahren 1955 / 57
auf dem Germansberg in Speyer knüpft an eine
altehrwürdige Tradition an. Wo sich einst fromme Christen schon zur Römerzeit
sammelten, wo später fromme Mönche das Lob Gottes sangen, erhebt sich jetzt
die neue Stätte des Speyerer Klerus. Alter Glaube und neue Zeit verbinden sich auf geschichtsträchtigem
Boden. Ausgrabungen 1946 / 47 brachten den Nachweis eines spätrömischen
christlichen Friedhofs, einer merowingischen Kirche und einer
frühmittelalterlichen Abtei. Als Patron des Speyerer Germansklosters
gilt der hl German, Bischof von Auxerre (gest. 448)
Dieser Bischof war einer der berühmtesten fränkischen Heiligen seiner Zeit. Im fränkischen König Dagobert (622 – 639) sah man den Gründer der
Abtei auf dem Germansberg, gesichert ist diese
Aussage aber nicht. Als ziemlich sicher gilt aber das 6. bis 7. Jahrhundert
als Gründungstermin. Nach einer Überlieferung war das Germansstift
ursprünglich ein Benediktinerkloster. Gesichert ist aber die merowingische
Kirche des 6. Jahrhunderts und die Existenz des Klosters für die Zeit König
Dagoberts. Dieses war die Mutterkirche der sich neu bildenden Speyerer Kirche
und vermutlich die älteste Bischofskirche, später St. German I genannt. Wie in jener Zeit üblich diente sie auch als Grablege und war
wahrscheinlich von Anfang an die Kirche des Klosters. Schon lange wirken im
Mittelalter, draußen vor den Toren der Bischofsstadt Speyer, auf dem
altehrwürdigen Germansberg, der ältesten
nachweisbaren christlichen Kultstätte des frühen Christentums in unserer
Gegend, fleißige Menschen, um das damalige Priesterseminar mit seiner neuen
Kirche fertig zu stellen. Mit der Wahl der Ausbildungsstätte für den
Priesternachwuchs auf dem Germansberg zu errichten,
hat man eine alte Tradition am alten Platz zu neuem Leben erweckt. Denn schon
Jahrhunderte lang befand sich am Germansstift eine
jener Stiftsschulen deren Aufgabe es war, junge Menschen für den
Priesterberuf auszubilden Im Jahre 1469 wurde das Stift in das Stadtinnere, auf den heutigen
Königsplatz, verlegt. Der Germansberg verlor seine
Bedeutung als Pflegestätte des Christentums mit dieser Verlegung hinter die Mauern
der Stadt. Der Grund für diesen neuen Platz war eine mehrmalige Zerstörung
der Stiftsgebäude, die gefährliche Lage außerhalb der Stadtmauern war nicht
länger hinzunehmen. Auf dem Germansberg blieb ein
Teil der Kirche als Kapelle erhalten und war Ziel einer alljährlichen
Gedenkprozession. Diese Kapelle ist noch auf einer Karte aus dem 18.
Jahrhundert verzeichnet und wurde vermutlich erst im 19. Jahrhundert
abgebrochen. Aber bereits im 18. Jahrhundert taucht der Gedanke auf, ein
neues Seminargebäude am Rande der Stadt entstehen zu lassen. Viel Zeit verging. Unter den wenigen Plätzen, die nun für einen
Neubau geeignet erschienen, fiel die Wahl auf den Germansberg,
nicht zuletzt deshalb, weil einst an dieser Stelle – wie berichtet – wohl das
älteste Heiligtum im Gebiet der Diözese stand. Die Bauzeit am Germansberg für das nun
neue Bischöfliche Priesterseminar war von 1955 – 1957. Die Weihe der Kirche
durch Bischof Isidor Markus Emanuel war am 18. Juni 1957. Im Jahre 2007 feiert man nun das 50 jährige Bestehen
. Eine Ausstellung zeigt die kulturhistorische und
kirchengeschichtliche Bedeutung des Germansberges
von der Römerzeit bis heute. Glasfenster von Valentin Feuerstein in der
Kapelle des Priesterseminars St. German zum Künstler: Valentin Feuerstein, geb. 1917 in Neckarsteinach,
stammt aus einer Malerfamilie. Er arbeitete im Betrieb seiner Eltern mit,
absolvierte eine solide Handwerkslehre. Krieg u. Arbeitsdienst durchkreuzten
seine Pläne, an der Kunstakademie in München zu studieren. Nach dem Krieg kam
er als Restaurator zur "Bauhütte Heilig Geist" in Heidelberg. 1955 fand er in der Glasmalerei seine Richtung. Aber nicht Kunst um
der Kunst willen war sein Ziel, sondern: die Botschaft der Bibel auf seine
Eigen-Art zu verkünden. Seine Werke sind u. a. zu sehen in Freiburg / Münsterrosette, Ulm: Fenster im Münster Heidelberg: Abtei Neuburg u.v. mehr 1982 schuf Valentin Feuerstein die Fenster der Kapelle des
Priesterseminars St. German in Speyer Beim Eintritt in die Kapelle ziehen fünf große Fenster den Betrachter
in seinen Bann: Blau herrscht vor, mit rot, grün und hellweiß
durchsetzt. Ein unterschiedlich breites gelbgoldenes Band verbindet die
einzelnen Fenster. Es ist unverkennbar, dass V. Feuerstein als großes Vorbild
Chagall liebte und schätzte. Erstes Fenster: Rettungsgeschichte aus dem Alten Testament: Noah und seine Arche,
Sündenfall und seine Folgen, Rettung und Verheißung an Abraham... Zweites Fenster: Mose im brennenden Dornbusch, Paschamahl, Auszug aus Ägypten, Zehn
Gebote... Drittes Fenster: Geschichte von Jona und weiteren Propheten Viertes Fenster: Neues Testament: Taufe Jesu - Wunder Fünftes Fenster: Letztes Abendmahl - Auferstehung Das gelbgoldene Band verbindet alle Fenster in einem Band der Berufung. Dies ist das Thema,
welches sich durch alle Fenster hinzieht: Vom Alten Testament her bis ins
Neue Testament, bis hin zu Jesus Christus die Grundlinien der Berufung, der
Sendung durch Gott, festzumachen an Persönlichkeiten, die dies mehr oder
weniger vollkommen lebten. |