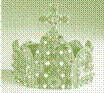|
Otto
von Freising |
Gesellschaft
e.V. |
|
Predigt anlässlich des Privilegienfestes
am 2. August 2008 im Speyerer Dom Liebe Schwestern und Brüder, die Person, um die es mir heute geht, beschreibt der
berühmte zeitgenössische Schriftsteller Umberto Eco in einem seiner Romane
mit folgenden Worten: „Otto war noch
nicht fünfzig, wirkte aber fast doppelt so alt. Immer ein bisschen hüstelnd,
geplagt von täglich wechselnden Zipperlein, mal Hüft-, mal Rückenschmerzen,
dazu ein Blasensteinleiden, auch etwas triefäugig wegen des vielen Lesens und
Schreibens, dem er sowohl im Licht der Sonne wie auch in dem einer Lampe
oblag. Überaus reizbar, wie es bei Gichtkranken häufig vorkommt…, im Grunde
ein herzensguter Mann…“ Wen beschreibt Eco hier in seinem Schelmenroman „Baudolino“? Es handelt sich bei dieser Person um den
wichtigsten Geschichtsschreiber des Hochmittelalters: Bischof Otto von
Freising. Er spielt in Ecos Roman eine wichtige
Rolle, wenngleich zugegebenermaßen Eco – wir kennen ihn ja – mit der
Geschichte sehr spielerisch umgeht und seiner Fantasie völlig freien Lauf
lässt. Mir geht es also heute um diesen Bischof Otto von
Freising, der vor genau 850 Jahren gestorben ist. Er hängt mit der Geschichte
der Salier, derer wir heute gedenken, ganz eng zusammen. Doch dazu muss ich
zu Beginn etwas ausholen und zunächst einmal seine Familiengeschichte und
seinen Stammbaum darstellen. Denn Otto ist nicht nur verwandt mit dem
Geschlecht der Salier, sondern auch mit dem Geschlecht der Staufer. Er ist
nicht mehr und nicht weniger als der Enkel Heinrichs IV., damit der Neffe
Heinrichs V., ein Halbbruder von Konrad III., dem ersten Stauferkönig, so
auch ein Onkel Friedrich Barbarossas, dessen Frau
Beatrix hier im Dom begraben liegt. Die prunkvolle Hochzeit Friedrichs mit
Beatrix 1156 in Würzburg - so
berichten die Quellen - hat auch Otto mitgefeiert. Otto ist daher auch ein
Großonkel von Philipp von Schwaben, der ebenfalls hier im Dom seine letzte
Ruhestätte gefunden hat, nachdem er vor 800 Jahren in Bamberg ermordet wurde.
Aber jetzt erst einmal der Reihe nach: Heinrich IV.
und seine Frau Berta hatten eine Tochter namens Agnes, genannt Agnes von
Waiblingen. Sie wurde zuerst vermählt
mit einem Staufen, nämlich Herzog Friedrich von Schwaben. Einer ihrer
Söhne aus dieser ersten Ehe war der spätere König Konrad III. Als Friedrich
starb, wurde sie im Rahmen der Heiratspolitik ihres Bruders - also Heinrichs V. - erneut vermählt und
zwar mit dem Babenberger Markgrafen Leopold III., der in Klosterneuburg bei
Wien residierte. Es ist Leopold der Heilige, der in Österreich als
Landespatron verehrt wird. Sein Gedenktag, der 15. November, wird bis zum
heutigen Tag in Österreich als staatlicher Feiertag begangen. Markgraf Leopold heiratet also im Jahr 1105 die
Tochter des Kaisers Heinrich. Diese Ehe ist sehr kinderreich. Das sechste
Kind, Otto, geboren um das Jahr 1112 vermutlich in Klosterneuburg, wird früh
für den geistlichen Stand bestimmt. Er soll einmal das Stift Klosterneuburg
als Propst übernehmen. Dazu muss er eine gediegene und solide Ausbildung
bekommen. Er wird im Jahre 1126 mit einigen Gefährten nach Paris geschickt.
Dort befindet sich damals die beste Ausbildungsstätte für Theologie. Einer
seiner Lehrer ist der berühmte Hugo von St. Viktor. Nach fünf Jahren hat Otto
seine Ausbildung beendet und will nach Hause zurückkehren. Unterwegs macht er
mit 15 seiner Gefährten Halt in einem
Zisterzienserkloster in der Champagne. Es trägt den Namen Morimund.
Darin steckt das lateinische „mori mundo“- wörtlich:
„Stirb der Welt!“, sinngemäß: „Entsage der Welt!“ Das Programm der Zisterzienser wird da mit einem
Wort ausgedrückt. Durch Gebet und Askese will man ein Leben führen, in dem
man Gott nahe kommt. Das Irdische kann dabei nur Mittel zum Zweck sein. Man
darf sich dadurch nicht vom eigentlichen Ziel ablenken lassen. Otto ist so
fasziniert von dem Geist der Zisterzienser, dass er seine Lebensplanung
radikal ändert. Er beschließt mit seinen Gefährten, nicht mehr
zurückzukehren, sondern als Mönch in das Kloster Morimund
einzutreten. Offensichtlich muss sein Vater diesen Entschluss wohl oder übel
akzeptieren. Otto ist so begeistert von der Lebensweise der
Zisterzienser, dass er seinen Vater drängt, ein eigenes Kloster für diesen
neuen Orden zu errichten. So gründet Leopold im Jahr 1133 das Stift
Heiligenkreuz im Wienerwald, ein Kloster, das bis heute besteht und
erfreulicherweise zurzeit wieder großen Zulauf hat. (Nur nebenbei sei
bemerkt, dass der Choralgesang der Zisterzienser von Heiligenkreuz vor kurzem
die Charts stürmte. Unter dem Titel „music for paradiese“ wird ihr
meditativer Gesang zurzeit hunderttausendfach verkauft.) Aber zurück zu Otto. Anscheinend hat sich der
Grafensohn als einfacher Mönch derart bewährt, dass er nach wenigen Jahren
zum Abt des Klosters gewählt wird. Doch kann er dieses Amt nur einige Monate
ausüben. Denn inzwischen ist der deutsche Kaiser Lothar von Supplinburg gestorben. Auf den Thron kommt als sein
Nachfolger Konrad III., also der Halbbruder Ottos. Als eine seiner ersten Aufgaben muss Konrad den
Bischofsstuhl von Freising besetzen, der gerade vakant geworden war.
Vermutlich konnte sich das Domkapitel in Freising nicht auf einen Kandidaten
einigen und trug an König Konrad die Bitte heran, ihnen einen Kandidaten zu
benennen. Offensichtlich hatte Konrad von seinem Halbbruder Otto eine gute
Meinung. Zudem brauchte er gegenüber dem welfischen
Herzog von Bayern - kein geringerer als Heinrich der Löwe - einen starken Nachbarn. Otto nimmt die Ernennung an. Er ist damit der erste
Zisterzienser in der noch jungen Geschichte des Ordens, der das Bischofsamt
übernimmt. Zeitlebens trägt er unter seinem bischöflichen Ornat die raue
Mönchskutte. Er zieht in die sicher damals bescheidene Residenz auf den Burgberg in Freising. Damals stand dort schon ein
romanischer Dom, ebenfalls eine Marienkirche. Übrigens findet sich heute auf
dem Domplatz in Freising eine Statue Ottos, dargestellt in bischöflicher
Kleidung und mit einem Buch, das ihn als Schriftsteller ausweist. Otto von Freising übernimmt ein heruntergekommenes
Bistum. Er bemüht sich tatkräftig um die Erneuerung des kirchlichen Lebens.
Den Klöstern Schäftlarn, Schlehdorf
und Innichen gibt er eine neue Ordnung. Die Klöster
Schliersee und Neustift
bei Freising gründet er neu. Zugleich ist er aber auch Reichsfürst und hat er
die vielfältigen Pflichten eines Landesherrn. Auch darüber sind eine Menge
Zeugnisse überliefert. Unter anderem findet sich in den Archiven eine
Urkunde, die bezeugt, dass Otto in Freising einen Rechtsstreit der Gastwirte
und Bierbrauer mit dem Kloster Weihenstephan schlichten muss. Interessanterweise fällt in sein Wirken das
Gründungsdatum der Stadt München –
allerdings ist er in dieser Geschichte leider der Verlierer. Der Hergang ist schnell
erzählt: Dem Bischof von Freising gehörte eine Brücke über die Isar bei Föhring. Dort wurde Markt gehalten, wurden Münzen geprägt
und Zoll eingenommen. Das Geld floss natürlich in die Kasse des Bischofs.
Heinrich der Löwe, der Herzog von Bayern, neidete ihm diese Einnahmen. In
einer Nacht- und Nebelaktion ließ Heinrich die Brücke zerstören. Gleichzeitig
ließ er etwas weiter südlich bei einem Dörfchen bei den Munichen (also bei den Mönchen
- einer Ansiedlung von Mönchen von Tegernsee) eine neue Brücke über die Isar
schlagen, so dass er nun selbst Zoll einnehmen konnte. Otto wollte nicht
klein beigeben und beschwerte sich bei Kaiser Friedrich Barbarossa. Auf einem Reichstag in Augsburg im Juni
1158 - es war kurz vor dem Tod Ottos – kam es zu dem berühmten „Augsburger
Schied“. Der Beschluss des Kaisers sollte die beiden bayerischen
Reichsfürsten wieder miteinander versöhnen. Zollbrücke, Markt und Münze
sollten in Föhring nicht mehr bestehen. Die neue
herzogliche Brücke bei Munichen sollte nun als Zollstätte dienen. Allerdings
musste ein Drittel der Erträge an den Bischof von Freising abgeführt werden.
Die Folgen der herzoglichen Gewalttat wurden also legalisiert. Otto hatte
dabei das Nachsehen, musste sich aber fügen. Der Augsburger Schied gilt
seitdem als Datum für die Gründung der Stadt München. Und so hat sie gerade
vor wenigen Wochen ihren 850. Geburtstag gefeiert. Die Bedeutung Ottos von Freising beruht allerdings
auf ganz anderen Verdiensten. 1143 beginnt er ein groß angelegtes
Geschichtswerk: die Chronica
oder Historia de duabus
civitatibus, die Geschichte der beiden Staaten
– also nach Augustinus das Miteinander und Gegeneinander des Gottesstaates
und der weltlichen Herrschaft, eine Weltgeschichte in acht Bücher. Die
Chronik schildert die Geschichte der Welt von der Erschaffung Adams bis zu
Ottos eigener Gegenwart. Darin beschreibt er auch viele Ereignisse, deren
Zeuge er war. Trotzdem bleibt er bescheiden im Hintergrund, und spricht von
sich lediglich in der dritten Person. Zugleich war ja die jüngere Geschichte
die Geschichte seiner unmittelbaren Vorfahren. So zitiert er auch die ersten
Zeilen des ergreifenden Briefs, den Heinrich IV. nach der Absetzung durch
seinen Sohn an Philipp, den König von Frankreich, geschrieben hat. Darin
beklagt Heinrich IV., wie er von seinem Sohn entmachtet und gezwungen wurde,
ihm die Reichskleinodien auszuliefern. Übrigens findet sich in einer
Handschrift der Chronik, die in der Universitätsbibliothek von Jena
aufbewahrt wird, auch eine schöne Federzeichnung (sozusagen ein
mittelalterlicher Comic). Die Zeichnung zeigt die Krönung Heinrichs IV. durch
den Gegenpapst Clemens. Dann das Schicksal des richtigen Papstes Gregor, der
erst in die Verbannung nach Salerno getrieben wird und dort stirbt. Das
letzte Bild zeigt, wie Gregor von zwei Bischöfen betrauert wird. Wörtlich zitieren möchte ich die kurze Passage, in
der Otto den Tod Heinrichs V., also seines Onkels, beschreibt, dem Speyer ja
seine Privilegien verdankt. „Als alles
wohl bestellt war, wollte Kaiser Heinrich auf den Rat seines Schwiegersohns,
des Königs von England, das ganze Reich steuerpflichtig machen. Er zog sich
dadurch aber den tiefen Hass der Fürsten zu. Um diesen neuen Unfrieden
beizulegen, wollte er nach dem Niederrhein ziehen, erkrankte aber in Utrecht
und starb dort im 19. Jahr seines Königtums, im 14. seines Kaisertums. Von
Utrecht wurde sein Leib über Köln nach Speyer gebracht, wo er neben seinem
Vater, Großvater und Urgroßvater, den
Kaisern mit höchstem Prunk beigesetzt wurde.“ Manche Forscher vermuten, dass Otto möglicherweise als etwa
13-Jähriger mit seiner Mutter damals an der Beisetzung seines Onkels hier in
Speyer teilgenommen hat. Mit König
Konrad III., dem ersten Staufer auf dem Königsthron, macht sich Otto
übrigens auch auf als Teilnehmer des 2. missglückten
Kreuzzugs, der hier im Dom mit der Predigt Bernhards von Clairvaux an
Weihnachten 1146 seinen verhängnisvollen Anfang nahm. Otto erreicht zwar
Jerusalem und besucht die heiligen Stätten. Aber viele seiner Begleiter
finden unterwegs den Tod. Nicht zuletzt durch diese Erfahrung des Scheiterns
erkennt Otto, wie brüchig und vergänglich alles menschliche Streben letztlich
ist. Als Chronist verbindet er immer wieder die geschichtlichen Fakten mit
einer theologischen Deutung. So schreibt er im Blick auf den Aufstieg und
Niedergang der verschiedenen Könige und Kaiser: Vor Gott, dem
Allmächtigen, ist nichts verborgen, er sieht arm und reich und erkennt hoch
und niedrig. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Unterdrückten…
Das Schicksal der irdischen Dinge… sollte uns anspornen, den Hochmut zu
meiden und nach Demut zu trachten. Und was lehrt uns das unglückselige
Geschick des Menschen, das ihn bald vom Bettelstab zur Königskrone emporhebt,
bald von der Königskrone zum Bettelstab hinabstürzt und ihn quält, (was lehrt
es uns anderes) als Verachtung der Welt und Sehnsucht nach dem himmlischen
Reich, in dem sich nichts ändert noch vergeht.“ (VII,24) Sein Neffe Friedrich Barbarossa, der 1152 König
wird, beauftragt Otto mit der Abfassung eines zweiten Geschichtswerks. Er
soll nun die Familiengeschichte der Staufer darstellen. Wenige Jahre vor
seinem Tod übernimmt Otto diese Aufgabe. Dieses zweite Geschichtswerk trägt
den Titel „Gesta Frederici“
(„die Taten Friedrichs“). Der erste Teil beginnt 1076 mit der Bannung
Heinrichs durch Papst Gregor. Am Anfang des zweiten Buches, das Otto nicht
mehr ganz fertig stellen konnte, steht die Krönung Barbarossas
zum deutschen König. Dabei schildert Otto die Geschehnisse um so detaillreicher, je näher er zeitlich selbst den
Ereignissen ist. Im Alter von nur 46 Jahren, am 22. September 1158,
stirbt Otto auf der Reise nach Citeaux, zum
Generalkapitel seines Ordens, in seinem Professkloster
Morimund.
Nahe beim Hochaltar der Abteikirche von Morimond
erhielt er sein Grab. Der symbolische Name des Klosters „Stirb der Welt!“
findet für ihn hier seine buchstäbliche Erfüllung. Im Gefolge der
Französischen Revolution wurde die Klosteranlage fast vollständig zerstört.
Sein Grab ist seitdem verschollen. Otto von Freising war eine wahrhaft europäische
Gestalt. Er hat buchstäblich Geschichte geschrieben: Ein Babenberger mit
salischen Wurzeln und Verwandtschaft zu den Staufern, ein Mönch und Bischof,
ein Reichsfürst und Chronist. Er hat buchstäblich und im übertragenen Sinne
Geschichte geschrieben. In Österreich und im Erzbistum München-Freising wird er als Seliger verehrt. Anlässlich seines
Todes vor 850 Jahren begeht die Erzdiözese München-Freising ein ihm
gewidmetes Gedenkjahr. Papst Benedikt XVI. kam bei seinem Österreichbesuch
im vergangenen Jahr auch ins Stift Heiligenkreuz, dem inzwischen eine
päpstliche Hochschule angegliedert ist. Bei seiner Predigt in der
Klosterkirche kam er auch auf Bischof Otto von Freising zu sprechen. Als
ehemaliger Erzbischof von München-Freising ist er ja selbst ein Nachfolger
auf dem Bischofsstuhl Ottos gewesen. In wenigen Worten gibt Papst Benedikt
eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn und Ziel der Geschichte. Seine
Überlegungen sehe ich als Fortsetzung der Geschichtsdeutung des Weltchronisten
Otto. Er beantwortet damit eine Frage, die uns alle irgendwie bedrängt und an
der keiner vorbeikommt. Was gibt uns – auch persönlich - Hoffnung und
Zuversicht, wenn die große und kleine Geschichte letztlich nur zeigt, wie
unbeständig und unberechenbar unser Leben ist, wenn es nichts anderes zu sein
scheint als ein ständiges, unvorhersehbares Auf und Ab? Daher möchte ich die
eindringlichen Worte des Papstes an den Schluss stellen: „Jeder Mensch
trägt im Innersten seines Herzens die Sehnsucht nach der letzten Erfüllung,
nach dem höchsten Glück, also letztlich nach Gott, sei es bewusst oder
unbewusst. Gott, der Schöpfer, hat uns Menschen nicht in eine beängstigende
Finsternis gesetzt, wo wir verzweifelt den letzten Sinngrund suchen und
ertasten müssten (vgl. Apg 17,27); Gott hat uns
nicht in einer sinnleeren Wüste des Nichts ausgesetzt, wo letztens nur der
Tod auf uns wartet. Nein! Gott hat unsere Dunkelheit durch sein Licht hell
gemacht, durch seinen Sohn Jesus Christus. … Noch viel mehr als wir Menschen
Gott je suchen und ersehnen können, sind wir schon zuvor von ihm gesucht und
ersehnt, ja gefunden und erlöst! Der Blick der Menschen aller Zeiten und
Völker, aller Philosophien, Religionen und Kulturen trifft zuletzt auf die
weit geöffneten Augen des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes; sein
geöffnetes Herz ist die Fülle der Liebe. Die Augen Christi sind der Blick des
liebenden Gottes.“ Gott hat unsere Dunkelheit durch sein Licht hell
gemacht, durch seinen Sohn Jesus Christus. Nicht mehr und nicht weniger als
dieses Licht der Hoffnung feiern wir, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir
heute hier in der Krypta des Domes zur Lichtermesse zusammenkommen. Josef D. Szuba |