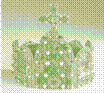|
|
Gesellschaft
e.V. |
|
Gedenkmesse zum 950. Todestag von Kaiser Heinrich III. 2006 wurde auch der 950. Todestag Kaiser Heinrich III. begangen. Er
geriet bei all den Veranstaltungen zum 900. Todestag seines Sohnes, Keiser
Heinrich IV., fast in Vergessenheit. Die Saliergesellschaft hat am Todestag des Kaisers, am 5. Oktober, in der
Krypta des Domes eine Gedenkmesse für Heinrich III. gefeiert, zelebriert von
Domkapitular Josef D. Szuba, musikalisch gestaltet vom kath. Kirchenchor aus
Otterstadt Hier die Predigt von Josef D. Szuba Einführung Vor 950 Jahren – am 5. Oktober 1056 – ist Kaiser Heinrich III. in seiner
Pfalz in Bodfeld im Harz gestorben. Er war gerade einmal 39 Jahre alt.
Am 28. Oktober, dem Festtag der Apostel Simon und Judas, wurde sein
Leichnam hier im Speyerer Dom beigesetzt. An der Seite seiner Eltern Konrad
und Gisela. Sein Herz – so verfügte er – ruht bis zum heutigen Tag in der Ulrichskapelle in Goslar. Wir wollen heute seiner besonders gedenken. Passenderweise ist heute zugleich der Gedenktag der Domweihe vor 945
Jahre. Fünf Jahre nach dem Tod Heinrichs wurde der Bau I vollendet und
eingeweiht. Heinrich hat am Dom seines
Vaters weitergebaut und ihn mit Schenkungen überhäuft. Das hier ausgestellte Faksimile des Codex
aureus ist so aufgeschlagen, dass man das Widmungsbild betrachten kann. Die Grablege der Salier dient heute noch in erster Linie dem, wozu sie
von ihren Stiftern geschaffen wurde: dem Lob Gottes. So wollen wir nun das
Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern – wie es in dieser Krypta
durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder geschehen ist. Wir dürfen das
Lob Gottes singen und dankbar derer gedenken, die uns dieses großartige
Gotteshaus geschenkt haben. Predigt Am Sterbelager Heinrichs III. – so berichten die Annalen – standen seine Getreuen, darunter der
Patriarch Gotebald von Aquileja, Bischof Gebhard von Regensburg und vor allem
sein Freund, Gebhard von Eichstätt, der nun als Papst Viktor II. die Kirche
regierte. Im Angesicht des Todes hatte Heinrich III. alle um Verzeihung
gebeten, die Nachfolge des 6jährigen Heinrichs IV. geregelt und durch die
Hand des Papstes die Sterbesakramente empfangen. Viktor II. nahm auch am 28. Oktober an der
Beisetzung in Speyer teil. Heinrichs Tod bedeutet Ende und Wende oder, wie die Historiker
sagen: Ausklang des
frühmittelalterlichen Gottgnadentums und Weihekaisertums, Beginn der
hochmittelalterlichen spannungsgeladenen Gegenübers der beiden höchsten
Gewalten - Kaiser und Papst. In diesem Jahr haben wir uns ja vor allem mit
der dramatischen Geschichte Heinrichs IV. beschäftigt, der vor 900 Jahren
verstorben ist. Fast hat er seinen Vater etwas in den Hintergrund gedrängt. Wer war Heinrich III. Geboren wurde er am 28. Oktober 1017. Wegen seiner
dunklen Hautfarbe nannte man in niger -
der Schwarze. Die Ahnenreihe seiner
Mutter Gisela führt zu den Königen von Burgund und Westfranken und damit zu
Karl dem Großen. Über beide Elternteile ist er mit den Ottonen verwandt. Mit
10 Jahren erlebte Heinrich die Kaiserkrönung seiner Eltern in Rom. Ein Jahr
später wurde er im Aachener Dom vom Erzbischof von Köln zum König gesalbt und
gekrönt. Er begleitete seinen Vater auf Hoftagen und Heerfahrten und wurde
schon früh mit politischen Aufgaben betraut.
Seine erste Frau war Gunhild, Tochter des Königs Knuds von Dänemark.
Sie starb bereits 1038 und ist im Kloster Limburg beigesetzt. Mit dem Tod Konrads II. 1039 trat der 22jährige Heinrich die Nachfolge
seines Vaters an. Am Weihnachtsfest 1046 wird er mit seiner zweiten Frau
Agnes von Poitou in Rom zum Kaiser gekrönt. Die Gestalt Heinrichs umweht etwas von der Aura des tragisch
Unvollendeten. Seine Regierungszeit war ohne Zweifel ein Höhepunkt in der
Geschichte des Mittelalters. Er wird beschrieben als gebildet, nachdenklich,
wortgewaltig. Drei Königreiche beherrschte er: Deutschland, Italien und
Burgund. Als Imperator Romanorum war er der ranghöchste und mächtigste
Monarch des Abendlandes. Er fühlte sich aber nicht nur als weltlicher
Herrscher, sondern auch als Gesalbter des Herrn, als Herr der Kirche. Souverän beherrschte er die Reichskirche,
entschied über die Besetzung von Bistümern und Abteien, verlieh den Bischöfen
und Äbten die Symbole des geistlichen Amtes Ring und Stab. In der Synode von
Sutri ließ er drei Päpste absetzen und bestimmte den Bischof von Bamberg
(Clemens II.) zum neuen Inhaber des Heiligen Stuhls. Inspiriert von der
cluniaszensischen Reformbewegung tat er viel für die Erneuerung und die
Glaubwürdigkeit der Kirche. 1. Heinrich als Kämpfer für den Gottesfrieden: „Ergreife, Kaiser, das Zepter des Reiches, beende die Kriege unter den Völkern, Der Friede beschütze die Städte des Erdkreises, und zu Pflugscharen schmiede die Schwerter.“ So ein Loblied aus jener Zeit auf Kaiser Heinrich III. Schwerter zu Pflugscharen das alte biblische Wort des Propheten Jesaja, vor
gut zwanzig Jahren aufgegriffen von der Friedensbewegung, ausgerechnet als
Programm eines mittelalterlichen Kaisers. Tatsächlich war es sein Bestreben,
den Gottesfrieden auszurufen. Eine Vision, die bis zum heutigen Tag aktuell
ist. Unerreicht, vielleicht unerreichbar
angesichts der vielen Kriege und Krisenherde auf unserer Erde. Aber
genauso wahr ist die Sehnsucht der Menschen nach dauerhaftem Frieden. Nach
einem Zusammenleben in Freiheit und Würde, ohne Kämpfe und Kriege, ohne
Terror und Gewalt. Auch die Politiker unserer Tage werden einmal daran
gemessen, wie viel sie zur Schaffung und Sicherung des Friedens beigetragen
haben. Schwerter zu Pflugscharen – das ist gerade heute ein hohes Ziel der
Weltpolitik, wenn man bedenkt, wie viel Geld sinnlos für Rüstung ausgegeben
wird, Geld, das man besser für Bildungs- Ernährungsprogramme ausgeben sollte.
Heinrichs Botschaft damals wie heute ist es: Kämpft unermüdlich für den
Frieden- im großen wie im kleinen! Tretet ein für die Menschenrechte und
sorgt euch um Leben in Gerechtigkeit. 2. Heinrich als Förderer der religiösen Reform. Manchmal sträuben sich
einem die Haare, wenn man sich der mittelalterlichen Kirchengeschichte
zuwendet. Neben heiligmäßigen Gestalten gibt es sehr viele Missstände. Das
Schisma mit drei Päpsten habe ich schon erwähnt. Das ein Bischof oder Papst
zu den Waffen greift, ist heute
ebenfalls unvorstellbar. Wie
verweltlicht die Kirche damals war,
könnte man an vielen Beispielen belegen. Heinrich lässt sich dadurch – wahrscheinlich durch seine zweite Frau
Agnes zusätzlich unterstützt – nicht beirren. Im Geist der Kirchenreform von Cluny kämpft er für die Erneuerung der
Kirche nach dem Evangelium. Er sieht sich als ihr oberster Schutzherr. Bei
der Mainzer Synode 1049 ist für die Zeitgenossen bemerkenswert sein
harmonisches Zusammenwirken mit dem Reformpapst Leo IX. Vom Ernst seiner
Aufgabe ist Heinrich ganz durchdrungen. Viele Zeitzeugen beschreiben seine
Frömmigkeit und Glaubensstrenge. „Ecclesia semper reformanda.“ Die Kirche ist zu allen Zeiten reformbedürftig. Auch heute brauchen wir Laien, die sich entschieden und glaubwürdig für
das Evangelium einsetzen – ohne Abstriche oder falsche Kompromisse. Die mit
ihrem Einsatz manchen müden Kirchenmann beschämen. Und vor allem brauchen wir
Politiker, die glaubwürdig sind. Die Werte und Überzeugungen authentisch
vertreten und fördern in einer Gesellschaft, wo alles gleich gültig und damit
gleichgültig geworden ist. Heinrichs
Botschaft damals wie heute für jeden Christen ist es: Trage bei zur
Erneuerung der Kirche, indem du glaubwürdig lebst, indem du immer wieder
fragst: Was erwartet Gott von mir? Wie kann ich das Evangelium umsetzen? Was
tue ich, um die kirchliche Gemeinschaft zu stärken und zu fördern? 3. Schließlich Heinrich als großzügiger Stifter des Domes. Noch heute
verehren wir in der Katharinenkapelle die Reliquien, die Heinrich von Papst
Clemens 1046 erhalten hat: Das Haupt des Märtyrerpapstes Stephanus, das Haupt
des Mönches Anastasius. Dazu die Reliquien von St. Guido, die ursprünglich
für das Johannesstift bestimmt waren. Reliquien waren – um es einmal profan auszudrücken – eine Art von Kapitalanlagen
des Mittelalters. Sie garantierten eine hohe Wertschätzung und Bekanntheit
des Ortes, wo sie aufbewahrt wurden. Sie förderten Wallfahrten und
Heiligenverehrung. Letztlich geht es in den Reliquien darum, anschaulich, ja
handgreiflich zu machen, dass das Heil nicht etwas Unwirkliches,
Überweltliches ist, sondern Gott sein Heil wirkt in und durch Menschen wie du
und ich, Menschen aus Fleisch und Blut, aus Haut und Knochen. Ein letztes kostbares Geschenk hat Heinrich dem Dom vermacht. Das Goldene
Evangelienbuch. Ein Kunstwerk ohnegleichen. Unvergesslich die Reise des
Faksimiles durch die Diözese im Jahr 1998. Über jedes Bild könnte man
tiefsinnige Bildbetrachtungen durchführen Die Liebe zum Wort Gottes, aber
auch zum Gottesdienst ist hier buchstäblich mit Händen zu greifen. Etwa das
Widmungsbild – erste Darstellung des Speyerer Domes Ein Thronsitz für Maria.
Heinrich und Agnes wenden sich ihr demütig und vertrauensvoll zu. Heinrichs
Botschaft damals wie heute lautet: Liebe das Wort Gottes, das unendlich
kostbar ist. Liebe die Kirche als deine Heimat. Sie ist ein Vorgeschmack
dessen, was uns erwartet, wenn wir vollendet werden in der Schar der
Heiligen, die uns im Glauben vorausgegangen sind. „Spira fit insignis Heinrici munere regis.“ Speyer wird im Glanz erstrahlen durch König Heinrich Gunst und Gabe. Diesen Satz finden wir im Codex aureus. Indem wir hier zusammenkommen,
bestätigen wir diese Aussage. In der Tat: Speyer – und nicht nur Speyer -
verdankt Heinrich III. viel. Darum wollen wir dankbar die Erinnerung an ihn
wach halten und seine Botschaft von Gottesfrieden und Kirchenreform, von der
Kostbarkeit des Wortes Gottes und dem Kirchenbau als Bild des himmlischen
Jerusalems diese seine Botschaft wollen wir treu bewahren und an künftige
Generationen weitergeben. Zurück zum Seitenanfang Zurück zu
Privilegienfest |