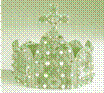|
|
Gesellschaft
e.V. |
|
|
Workshop
am 10. September 2002 Noch einmal Canossa Unser
Septemberstammtisch diente der Einstimmung auf die Herbstfahrt nach Canossa.
Unser Schatzmeister Herr Feichtner hat sich für
seine Salier vorbereitet. Er wollte uns
nicht unwissend und schutzlos die Alpen überqueren lassen. Die Redewendung:
"Der Gang nach Canossa...",ist für die
meisten von uns ein fester Begriff. Er beschreibt den Zustand eines Bußgang einer Demütigung. Aber Hand aufs
Herz!!! Wer von den Anwesenden hätte gewusst, woher dieser Ausspruch kommt.
Wer hat ihn das erste mal
geprägt oder erfunden? Ich wusste es nicht. Herr Feichtner
hat nachgeforscht und wurde fündig! Es war unser ehemaliger Reichskanzler
Fürst Otto von Bismarck. Bei einer Reichstagssitzung 1872 brillierte er mit
dieser Redewendung. "Nach Canossa gehen wir nicht." Er wollte keinen
solchen Gang gehen.(Ursache dieser Verstimmung war die Besetzung der
kaiserlichen Gesandtschaft beim Hl. Stuhl.) 925 Jahre nach
dem historischen Gang Kaiser Heinrich IV. sind wir dem Wunsch einiger
Mitglieder nachgekommen und unternehmen unseren Gang nach Canossa. Herr Feichtner machte uns zuerst einmal bewusst, wie gut wir
es doch haben. Keinen anstrengenden Ritt zu Pferd über die Alpen, kein Eis
und Schnee im September, wie im Januar l077. Dazu würden wir auch noch bequem
von der Firma Deutsch von Ort zu Ort gefahren werden. Auch wäre unsere Route
viel kürzer als damals Kaiser Heinrichs Weg über Besancon,
Genf, den Mont - Cenis,
Turin, Pavia bis Reggio. Wir müssten nur durch die
Schweiz fahren. Wir hätten
auch nur ein paar läppische Fränkli als Mautgebühr
zu entrichten. Der Kaiser
dagegen musste seiner geschäftstüchtigen Schwiegermutter, Adelheid von Turin,
eine ganze Abtei am Genfer See abtreten, um ihr Gebiet passieren zu dürfen.
Als Gegenleistung verpflichtete er sie aber dazu sich bei den bevorstehenden
Verhandlungen mit Papst Gregor VII. für die Sache des Kaisers einzusetzen. Herr Feichtner meinte dass er die ganze Breite der Geschichte
dieser Auseinandersetzung zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII.
nicht darstellen müsse, dies setzte er als bekannt voraus. Nur so viel, für
einige Tage wurde die Burg Canossa zum politischen Mittelpunkt der damaligen
christlichen Welt. Aber wer war
eigentlich diese Mathilde von Tuscien, die Herrin
von Canossa? In Italien sind die Menschen sehr stolz auf ihre Marktgräfin.
Herr Feichtner hat uns die Geschichte ihrer Familie
erläutert. Adelheid, die
junge Witwe Königs Lothars, wurde 951 von Marktgraf Berengar
II. gefangen gesetzt. Er wollte auf diese Weise die Witwe zur Ehe mit ihm
zwingen. Aber das störrische Frauenzimmer entzog sich ihm durch Flucht.
Adelheid wandte sich an den Bischof Adelhard von
Reggio um Hilfe. Dieser schaltete seine Vasallen den Urgroßvater von
Mathilde, Atto I. von Canossa ein. Er gewährte der königlichen Witwe Schutz
und Hilfe und vermittelte die Ehe mit Kaiser Otto dem Großen, die noch im
gleichen Jahr 951 in Pavia geschlossen wurde. Fortan war
Atto einer der treuesten Vasallen des Kaisers. Sein Sohn Tedald
und sein Enkel Bonifaz setzten die kluge Politik Attos fort und erweiterten ihr Herrschaftsgebiet um
Modena und Mantua. Bei dem Tode von Kaiser Heinrich II. ergriff Bonifaz sofort die Partei des Saliers Konrad II., was dann zu einer engen Gefolgschaft zum Kaiserhaus
führte. Als Heinrich III. der Sohn des Kaisers im Jahre 1036 Gunhild
ehelichte, war Bonifaz in Nimwegen zugegen. Hier
lernte er Beatrix von Lothringen, eine Nichte von Kaiserin Gisela, seine
Spätere Frau, kennen. Bonifaz begleitete Kaiser
Konrad II. bei seinen Italienzügen. Er war an seiner Seite bei den Kämpfen um
die Städte Mailand, Verona und Parma. Jetzt erreichte der Besitz derer von
Canossa seine größte Ausdehnung, von Rom bis zum Gardasee und von
Küste zu Küste. Nach dem Tod seiner ersten Frau Richilde
heiratete Bonifaz im Jahre 1037 Beatrix von Bar.
Jetzt haben wir die Eltern von Mathilde. Die Hochzeit soll 3 Monate gedauert
haben. (Arme Windsors.) Der Bräutigam war 50 Jahre und die Braut zwischen 20
und 30 Jahren. (Na, ja !) Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, Beatrix, und
Friedrich, die sehr früh starben, und eben Mathilde. In späteren Jahren
kühlte das gute Verhältnis zum Kaiserhaus merklich ab. Bei einem Jagdausflug
am 6. Mai 1052 fand Bonifaz den Tod, wahrscheinlich
durch Mord. Mathildes
Mutter heiratete 1054, ohne die Erlaubnis des Kaisers einzuholen, ihren
Verwandten Gottfried den Bärtigen. Das war ein Affront. Immerhin war Beatrix,
eine Nichte der Kaiserin Gisela. Gottfried von
Lothringen, war eine undurchschaubare Persönlichkeit, machtbesessen,
intrigant und stets zur Rebellion gegen den Kaiser bereit. Bereits bei der
Hochzeit von Beatrix und Gottfried wurden die Kinder der Brautleute, nämlich
Mathilde von Tuscien und Gottfrieds Sohn, Gottfried
der Bucklige, zur späteren Ehe versprochen. Kurz vor Gottfrieds Tod 1069 kam
diese Ehe dann zustande, wenn auch zögerlich von Mathildes Seite. Aus der
Verbindung ging ein Mädchen hervor, welches aber sehr früh verstarb. Mathilde
floh förmlich vor ihrem Mann und kehrte nach Italien zurück. Da selbst der
Papst keine Versöhnung zwischen den Eheleuten erreicht ,
entwickelten sich auch die Interessen der Beiden auseinander. Gottfried wurde
Parteigänger von Heinrich IV. und Mathilde blieb ihr ganzes Leben lang, der
Kirche und der Sache des Papstes treu. Im Februar
1076 wurde Gottfried der Bucklige in Antwerpen auf schauerlichste Weise
ermordet. im April des gleichen Jahres starb auch Beatrixi,
Mathildes Mutter. Mathilde war einzige Erbin eines riesigen italienischen und
lothringischen Besitzes geworden und außerdem zum erstenmal
frei. Jetzt konnte sie über sich selbst bestimmen. Richtig
bekannt wurde ihre wichtige Stellung innerhalb der Christenheit schon im
Januar 1077 als sie im Streit zwischen den beiden mächtigsten Gestalten
Europas, ihrem Vetter, dem deutschen Kaiser Heinrich IV. und Ihrem
persönlichen Freund, Papst Gregor VII., die
Vermittlerrolle übernahm. Die nächsten Jahrezehnte
waren geprägt durch die Dauerauseinandersetzungen mit Kaiser Heinrich IV. Als
1084 Papst Gregor VII., ihr langjähriger Vertrauter
und Freund, gestorben war, benötigte Mathilde Schutz. Den hoffte sie in einer
neuen Ehe zu finden. Sie heiratete 1089 den 25 Jahre jüngeren Graf Welf V.
Die Ehe hatte keinen Bestand aber ständige Streitereien und Kriege mit dem
deutschen Kaiser gab es trotzdem. Erst mit dem Tod des Kaisers im Jahre 1106
in Lüttich änderte sich die Situation. Der Sohn des Kaisers, König Heinrich
V., versöhnte sich mit ihr, als er zur Krönung 1111 nach Rom reiste. Am 24. Juli
1115 starb Mathilde in Bondeno. Mathilde, die
große Gräfin, wie sie überall in Italien genannt wird, war größte Grundherrin
der italienischen Halbinsel, Herrscherin über Tuszien
und Teile der Lombardei, berühmte Jägerin und
Reiterin, kluge Diplomatin. Schlugen Verhandlungen fehl, so zog sie an der
Spitze ihres Heeres in die Schlacht. Sie war Gründerin der Rechtsschule in
Bologna, Richterin an eigenen Gerichtshöfen außerdem großzügige Stifterin von
Kirchen, Klöstern und Spitälern, Unterstützerin des Papstes. Auf Canossa
hat uns Herr Feichtner gründlich vorbereitet. Aber außer
Canossa besuchen wir noch unsere Partnerstadt Ravenna und die Abtei Pomposa und unsere müden Häupter und Gebeine legen wir in
Ferrara nieder, Essen gibt's dort dann hoffentlich auch. Uff die Bähm, die Pälzer kummen!!! Lilo
Schweickert |