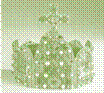|
|
Gesellschaft
e.V. |
|
Predigt in der Krypta des Speyerer Doms am 28. Oktober 2017 anlässlich des 1000.
Geburtstages Kaiser Heinrichs III. Als Kaiser Heinrich
III. am 5 .Oktober 1056 starb, wurde sein Körper nach Speyer überführt und am
28. Oktober – seinem Geburtstag – hier bestattet. Sein Herz hingegen blieb in
Goslar. Dort wurde es in der Vierung der Stiftskirche beigesetzt. Das Stift
St. Simon und Judas neben der Kaiserpfalz war eine Gründung Heinrichs: eine
dreischiffige Basilika von gewaltigen Ausmaßen. Leider wurde die Stiftskirche
Anfang des 19. Jahrhunderts aufgegeben und als Steinbruch benutzt. Erhalten
geblieben ist lediglich die gewaltige südliche Vorhalle, die noch etwas von
der alten Pracht erahnen lässt. Mehr als
zweihundert Jahre nach dem Tod Heinrichs erteilte das Stiftskapitel den
Auftrag, ein neues, figürliches Grabmal zu schaffen, das bis auf den heutigen
Tag erhalten geblieben ist. Es zeigt Kaiser Heinrich lebensgroß als
Liegefigur, jung, bartlos, in höfischer Kleidung, mit Krone und Zepter, den
Insignien seiner Macht, zu seinen Füßen ein Hund als Symbol der Treue. Im Arm
trägt er ein Modell der Stiftskirche, die ja seine Lieblingsgründung war.
Nicht von ungefähr hatte sie als Patrone die Apostel Simon und Judas. Ihr
Fest am 28. Oktober war ja zugleich sein Geburtstag. Offensichtlich fühlte er
sich dadurch mit den beiden Heiligen sehr verbunden. Nach den
Abriss der Stiftskirche fand das Grabmal seinen neuen und würdigen Platz in
der Ulrichskapelle der benachbarten Kaiserpfalz.
Das Grabmal ist ein Beispiel für die im 13. Jh. zunehmende
Stifterverehrung. Darüber hinaus
handelt es sich um eines der wenigen figürlichen Grabmäler für einen
deutschen König, die uns erhalten geblieben sind. (Ein weiteres aus dieser
Epoche für König Rudolf von Habsburg finden wir ja in der Vorhalle zur
Grablege hier im Dom.)
Damit wurde
quasi ein Begräbnisgottesdienst simuliert, eben ein Gottesdienst, bei dem der
Leichnam anwesend ist. Dazu – so die
genauen Anweisungen – war eine Predigt des heiligen Augustinus vorzulesen,
eine Predigt, in der er das 4. Kapitel des 1. Thessalonicherbriefes
auslegt. Augustinus führt darin folgende Gedanken aus: Wenn wir die Todestage
unserer Verstorbenen feiern, so sind wir verpflichtet, zweierlei zu bedenken:
dasjenige, was zu erhoffen und dasjenige, was zu befürchten sei. Beides beschreibt die Heilige Schrift: Den
Sündern droht das ewige Feuer, die Gerechten erwartet das ewige Leben. Entscheidend ist der Glaube an Jesus
Christus. Wer lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben, zitiert der Kirchenvater dann das
Johannesevangelium (Joh 11,26). Nach dem Ende
der Vigil wurde eine Kerze entzündet. Die sollte die ganze Nacht vor der
Grabplatte brennen. Vor der Messe am
Morgen waren wiederum alle Glocken zu läuten.
Nach dem feierlichen Gottesdienst sollten Almosen an die Armen
verteilt werden. – Offensichtlich war das Gedenken an Heinrich III. in Goslar
auch vierhundert Jahre nach seinem Tod noch sehr lebendig. Die Sorge um das Seelenheil führte zu
einer „Ethik des Aneinanderdenkens
und Füreinanderhandelns“ (Jan Assmann). Wir kennen
diese Haltung ja auch hier aus Speyer vom Privilegienfest,
wenn zugleich mit den verstorbenen Herrschern auch der Armen gedacht wird. Auf eine zweite
Darstellung Heinrichs möchte ich noch eingehen: Das Widmungsbild unseres
Codex aureus, dessen Seite hier vorne aufgeschlagen
ist, zeigt ihn im Purpurmantelzusammen mit seiner Frau Agnes. Demütig
überreicht er der Gottesmutter das goldene Evangeliar,
das er gestiftet hat. Zugleich legt Maria segnend die Hand auf Kaiserin
Agnes. Der Kaiser, so die Umschrift – betet zu Maria, sie möge ihm und seiner
Familie zu allen Zeiten Helferin und Gönnerin sein. In den Medaillons finden
sich die Personifikationen der vier Kardinaltugenden: die Gerechtigkeit, das
rechte Maß, die Tapferkeit und die Klugheit.
All jene Tugenden, die einen Herrscher auszeichnen sollen, der sich am
Evangelium orientiert, jene Tugenden, die er immer wieder erbitten und
anstreben muss. Maria wird als
Sitz der Weisheit dargestellt. In ihr hat sich die Menschwerdung Gottes
vollzogen. Sie repräsentiert das Heilsgeheimnis, dass Gott in diese Welt
kommt und uns begegnen will. Die ewige Weisheit Gottes hat Fleisch angenommen
in Jesus Christus. Hinter der thronenden Muttergottes sehen wir eine stilisierte
Darstellung unseres Doms. Nicht zufällig hat er in der unteren Reihe zwölf
Fenster. Sie erinnern an die zwölf Apostel, auf die die Kirche gegründet ist.
Zwei davon feiern wir ja heute. Es ist ja auch kein Zufall, dass das
Hauptschiff unseres Domes bis heute
auf jeder Seite von zwölf mächtigen Bögen getragen wird. Sie weisen
hin auf das himmlische Jerusalem mit seinen zwölf Toren, wie es die
Offenbarung des Johannes beschreibt (Offb 21,10ff).
„Spira
fit insignis Heinrici munere regis.“ – Speyer wird im
Glanz erstrahlen durch König Heinrich Gunst und Gabe. Diesen Satz lesen wir
über der Darstellung des Domes im Codex aureus. In
der Tat: Speyer – und nicht nur Speyer - verdankt Heinrich III. viel. Dankbar
wollen wir heute seiner gedenken. Auch wenn tausend Jahre zwischen ihm und
uns liegen. Die Grundlagen unseres Glaubens haben sich nicht geändert. Wir
hören das Wort Gottes. Wir feiern die Eucharistie und begegnen dem
gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wir vertrauen darauf, dass Gott
uns durch die Geschichte begleitet und uns Hoffnung schenkt auf das ewige
Leben. Das wollen wir jetzt gleich im
Apostolischen Glaubensbekenntnis, das
ja – wie der Name sagt – auf die Apostel zurückgeführt wird. Jeder von ihnen,
so sagt eine schöne Tradition, hat einen der zwölf Artikel beigesteuert.
Beten wir es gemeinsam in der Gewissheit, dass wir damit ein festes Fundament
unter den Füßen haben, das uns hilft, was auch immer kommen mag,
zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Josef D. Szuba
Literatur: Wolfgang Beckermann. Das Grabmal Kaiser Heinrichs III. in Goslar
(Beiträge zur Geschichte, Kunst und Kultur des Mittelalters, Band 3, 1998 Das Herz Heinrichs III. Herrschersakralität,
Raumvorstellungen und der tote und der lebende Körper des Königs, in: Verfassungsgeschichte
aus internationaler und diachroner Perspektive, hg.
von Franz-Josef Arlinghaus, Bernd Ulrich Hucker und Eugen Kotte, München
2010, S. 175-192 Das Goslarer
Pfalzstift St. Simon und Judas und das deutsche Königtum in staufischer Zeit. Bernd Schneidmüller, in: Geschichte in
der Region. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Schmid, hg.
von Dieter Brosius/Christine van der Heuvel/Ernst Hinrichs/Hajo van Lengen. Hannover: 1993,
29-53 Tillmann Lohse.
Das Goslarer Pfalzstift St .Simon und Judas: Eine Stiftung für die Ewigkeit?;
in: Harz-Zeitschrift Band 54/55 (2002/2003); S. 85-106 Das salische Kaiser-Evangeliar. Der
Kommentar, Johannes Rathofer (Hrsg.), mit einem
Geleitwort von Bischof Anton Schlembach. Münster u. a., Verlag Bibliotheca Rara. 1998. Speziell zum Thema: Bd. I.:
Joachim Gaus. „Quod est coelum, hoc est liber“ – Der Miniaturenzyklus
des Codex aureus escorialensis
im Licht frühmittelalterlicher Herrschertheologie. Das Dedikationsbild, S.
442ff Zur Frage der
genauen Datierung des Geburtstages: http://www.regesta-imperii.de/nachrichten/aktuelles/details/heinrichiii-mit-neuem-geburtsjahr.html Zurück
zum Seitenanfang Zurück zu Privilegienfest |