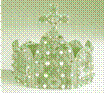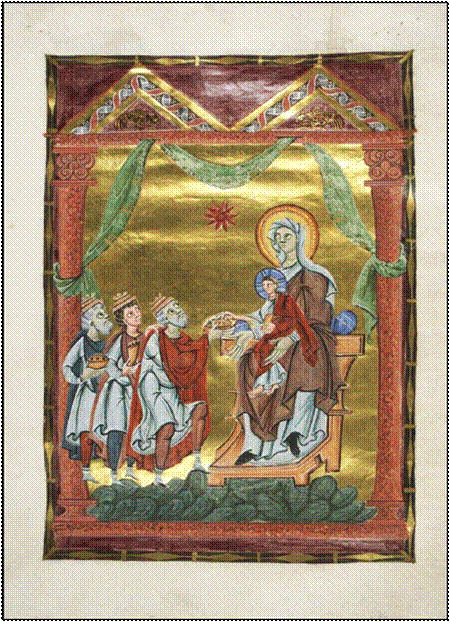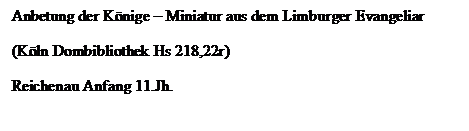|
|
Gesellschaft
e.V. |
|
Predigt bei
der Lichtermesse am 4. August 2018 im Dom zu Speyer Bei den hohen Temperaturen, die
derzeit herrschen, möchte ich Sie kurz an die Haardt
entführen. Genauer gesagt zum Kloster Limburg bei Bad Dürkheim,
das ja mit der Geschichte der Salier eng zusammenhängt. Zu Beginn seiner
Regierungszeit beschloss Konrad II. die bisherige Salierburg in ein Kloster
umzuwandeln – wohl aus Dankbarkeit über seine Wahl zum König. Vermutlich am
12. Juli 1025 erfolgte die Grundsteinlegung. Die Bauaufsicht übertrug er
Bischof Walter von Speyer. 1034 zogen die ersten Mönche ein. Sie kamen aus
dem Kloster St. Maximin in Trier. Verantwortlich
für die Besiedlung war ein Mann der clunesazenischen
Kirchenreform, Poppo von Stablo,
Abt des dortigen Reichsklosters, dem heute belgischen Stavelot.
Nicht
von ungefähr sind es idealtypisch genau zwölf Mönche, gemäß der Zahl der
Apostel, die das Klosterleben hier beginnen. Jedes Kloster versteht sich ja
als Jüngergemeinschaft, die dem Vorbild der ersten
Christen folgt. Mit dem gemeinsamen Gebet und der Gütergemeinschaft, wie es
uns die Apostelgeschichte berichtet (vgl. Apg
2,43). Beispielhaft möchte ich einige Kernaussagen aus dem Prolog der Benediktsregel zitieren, die nichts von ihrer Aktualität
verloren hat: „Öffnen wir
unsere Augen dem göttlichen Licht, und hören wir mit aufgeschrecktem Ohr, wozu uns die
Stimme Gottes täglich mahnt und aufruft. Gürten wir uns also mit Glauben und Treue im Guten, und gehen wir unter der Führung des Evangeliums
seine Wege, damit wir ihn schauen dürfen, der uns in sein Reich
gerufen hat. Wollen wir in seinem Reich und in
seinem Zelt wohnen, dann müssen wir durch gute Taten
dorthin eilen; anders kommen wir nicht ans Ziel. Lass dich nicht sofort von Angst verwirren und
fliehe nicht vom Weg des Heils; er kann am Anfang nicht anders sein als eng. Wer aber im klösterlichen Leben
fortschreitet, dem wird das Herz weit, und er läuft in unsagbarem Glück
der Liebe den Weg der Gebote Gottes.“ Die Klosterkirche Limburg wurde zu
Ehren des hl. Kreuzes errichtet: eine dreischiffige Säulenbasilika mit einer
Gesamtlänge von 81 Metern und der maximalen Breite in den Querschiffen von 40
Metern. Ihr Grundriss ist das lateinische Kreuz. Bekannt ist die
Gründungslegende: Kaiser Konrad habe an einem Tag den Grundstein für
die Limburg, den Speyerer Dom und das
Johannesstift gelegt. Wenngleich das historisch nicht haltbar ist, verweist
doch diese Legende auf den engen Zusammenhang dieser bedeutenden salischen
Kirchenbauten. Leider erinnern heute nur noch die Ruinen an den Glanz der
mächtigen Klosterkirche. Sie war angelegt buchstäblich wie eine „Stadt auf
dem Berg“, die nicht verborgen bleiben kann (vgl. Mt
5,14). Schon von weitem war sie zu sehen. 1065 schenkt Heinrich IV. die Abtei
dem Bistum Speyer. Später geht die Verantwortung auf die Leiniger
Grafen über. Schon 1504 wird das Kloster tragischerweise
durch den Bayerischen Erbfolgekrieg zerstört. Die Mönche flüchten gerade noch
rechtzeitig nach Speyer und bringen ihre Bibliothek und ihre Kirchenschätze
mit. Es sind ausgerechnet die Truppen des Leininger Grafen, der eigentlich
der Schutzherr des Klosters sein sollte, die das Kloster ausrauben und
anzünden. Der Versuch, die Abtei wieder aufzurichten, wird 1525 durch den
Bauernkrieg jäh beendet. Aber erst 1571 erfolgte die endgültige
Säkularisierung durch den Kurfürsten der Pfalz. Der Prior und die beiden
letzten Mönche übersiedeln nach Dürkheim. Kloster
und Kirche bleiben dem Verfall überlassen. Ein Kuriosum am Rande: Als der
amerikanische Schriftsteller James Fenimore Cooper
1831 eine Europareise machte, kommt er auch in die Pfalz. Als er Dürkheim besucht, hört er von der Geschichte des Klosters
Limburg. Sie regt ihn an zu einem dicken Roman „Die Heidenmauer oder die
Benediktiner. Roman über die Zerstörung der Limburg.“ – sicher ein spannende
Lektüre für lange Winterabende. Aber kehren wir zurück zur Epoche der
Salier. Konrad II. hielt sich häufig auf der Limburg auf. 1035 formulierte er
in einer Urkunde die Rechte der Abtei. 1038 wurde dort die junge Frau von
Heinrich III. bestattet Gunhild, die
Tochter des Dänenkönigs Knut. Wer war diese Frau, deren Grab 1938 bei Grabungen
entdeckt wurde? Ihre Grabplatte ist ja heute sichtbar vor dem Altarbereich zu
sehen. Wir wissen nur wenig über diese
junge Frau. Um das Jahr 1020 wurde sie geboren. Ihr Vater, Knut der Große
herrscht damals über Dänemark und England. 1036 findet am Pfingstfest in
Nimwegen die Hochzeit mit dem Thronfolger statt. Bereits zwei Jahre später
stirbt Gunhild in Oberitalien. Ihr einbalsamierter Leichnam wird nach
Deutschland zurückgebracht und in der Klosterkirche Limburg beigesetzt. Im
November 1038 kehrt Kaiser Konrad von seinem Aufenthalt in Burgund zurück, um
ihr Grab aufzusuchen. Dabei kommt es
zur berühmten sog. „Limburger Synode“. Bei seinem Aufenthalt in Straßburg
will der dortige Bischof Wilhelm, ein Onkel des Kaisers, schon am 26.
November den 1. Advent feiern. Er ist der Auffassung, die Adventszeit müsse
immer ganze vier Wochen umfassen – auch dann, wenn der 4. Advent auf einen
Sonntag fällt. Den Kaiser überzeugt er damit nicht. Als Konrad eine Woche
später auf der Limburg weilt, lässt er am 3. Dezember 1038 durch die ihn
begleitenden Bischöfe die bis heute gültige Regelung
aufstellen. Anwesend waren die Bischöfe Azecho von Worms, Reginbald von Speyer, Heribert von Eichstätt, Thietmar von Hildesheim sowie Walter von Verona. Diese
Regelung wurde später von dem Konzil von Trient bestätigt und
gilt wie gesagt weltweit bis heute. Wenn Sie also wieder einmal vor
Weihnachten in Hektik geraten, weil der Advent nur drei Wochen hat und der 4.
Advent gleichzeitig der Heilige Abend ist, wissen Sie jetzt, dass Sie diesen
Umstand zu verdanken haben: der Limburger Synode von 1038. Abschließend möchte ich noch auf eine
große Kostbarkeit eingehen, der aus dem Kloster Limburg stammt und glücklicherweise bis heute erhalten ist. Im Kölner Domschatz
können Sie das Limburger Evangeliar bestaunen. Ein
Kodex, der um das Jahr 1020 im Kloster Reichenau
entstanden ist und den Konrad II. dem Kloster Limburg geschenkt hat. Von der
Anlage her ist er mit unserem Speyerer Kodex vergleichbar. Es finden sich
darin die klassischen Einleitungen der Kirchenväter, dann die Kanontafeln, also die damalige Leseordnung. Der Bibeltext
wird illustriert durch einige wunderbare Buchmalereien. Ein Bild daraus ist auf der Titelseite
unseres Liedblatts abgedruckt. Es ist die Dreikönigsdarstellung. Schauen wir
uns diese Buchmalerei einmal genauer an: Umrahmt von zwei Säulen unter einem
Doppelgiebel sehen wir die Anbetung der Könige. Maria sitzt auf einem breiten
Thron, das Kind auf ihren Schoß. Sie schaut aufmerksam auf den Stern, der den
Weisen aus dem Morgenland den Weg gezeigt hat. Die drei Könige kommen von links. Der erste
reicht eine Schale nach oben, die Christus mit der Rechten entgegennimmt.
Gerade im Mittelpunkt des Bildes begegnen sich die Hände und setzen so einen
beziehungsreichen Akzent. Hier
begegnen sich Himmel und Erde. Gott und Mensch. Was die Propheten verheißen haben, wird
Wirklichkeit. Die Vertreter der Völker kommen und beten den Messias an. Buchstäblich
eine Sternstunde der Heilsgeschichte. Zur Interpretation des Bildes möchte
ich abschließend einen Text hinzufügen, einen Christus-Hymnus, der von dem
berühmten Mönch und Dichter Gottschalk
von Limburg stammt. Er wurde um das Jahr 1020 geboren. Teilweise muss er sich
auch im Kloster Klingenmünster aufgehalten haben. Wegen seiner Begabung wird er von Heinrich
IV. zum Hofkaplan, wohl auch um Sekretär gemacht. Er stirbt 1098. Er schrieb zur Oktav des Epiphaniefestes einen Hymnus, den ich abschließend
auszugweise rezitieren möchte:
Laus tibi, Christe, sponso sponsae, laus in te trinitate sanctae Quia mundi sator salus est et reparator. Lob
sei dir, Christus, Gemahl der Braut, lob
durch dich heiliger Dreieinheit. Schöpfer
der Welt bist du, und
ihr Heil und Befreier. Quell,
der aus Güte springt, ewiger Heimgang, Urgeburt
der Dinge, Ende des Geschehens. Du
aus dem Vaterherz einzig Geborener, zu
Brüdern hast du in Liebe uns bestimmt. Einst
hat der Vater uns im Geiste liebend
durch dich geschaut und geschaffen. Waltender,
Gestaltender, du
formst als Künstler uns in bunter Schönheit. Friede
im Herzensgrund bist
einzig du, o Christus, warst
als Erlöser arm
und trauernd, lieb und leidend. Sünden
versuchen uns, vergib
uns unsere Schuld, tägliches
Brot du, führe
uns heim ins Reich des Vaters. Du
Sonne, vom Stern geboren, in
Weihrauch, Gold und Myrrhe zeigt
dich der Heiden Stern als
Herrn, du König und sterblich zugleich.
In
Wein verwandle das Wasser und
das Gesetz in Gnade; das
Vorbild weiche der Wahrheit, die
Knechtschaft den Himmelserben. In
vinum converte aquam et legem in gratiam, pro figura veritas pro iugo tu heriditas.
Josef D. Szuba Literatur:
Jens
Werner, Kloster zum heiligen Kreuz Limburg. Aktion
Limburg e. V. Bad Dürkheim.1993 Walter
Schenk, Das Kloster Limburg an der Haardt. Neustadt/Weinstraße 2002 Hansmartin Schwarzmaier, Von Speyer
nach Rom. Wegstationen und Lebensspuren der Salier. Sigmaringen 1991; Der
Bruder des Papstes als Bischof. S. 66ff; Das Kind als Königin. „Gunhild“
(+1038) am deutschen Hof., S. 72ff Peter
Bloch. Die beiden Reichenauer Evangeliare im Kölner
Dom; Kölner Domblatt. Jahrbuch des
Zentral-Dombauvereines 1959, S. 9ff Das Reichenauer Evangeliar aus Limburg an der
Haardt in der Kölner Dombibliothek (Cod. 218). Kirchenpolitik und Liturgie, in: Libelli Rhenani 62, Köln 2015 Benediktsregel:
http://www.stiftmelk.at/frame_regula.htm Zurück zum Seitenanfang Zurück zu Privilegienfest |